- Zugriffe: 10852
Geschichte unserer Wanderwege
Der Fremdenweg
Erste Fernwanderwege
1904 Kammweg ![]() Jeschken-Rosenberg, bald erweitert bis Hainberg bei Asch und die Schneekoppe einbezogen, danach gar Wartburg-Altvater entlang
Jeschken-Rosenberg, bald erweitert bis Hainberg bei Asch und die Schneekoppe einbezogen, danach gar Wartburg-Altvater entlang
der Kammlinien von Thüringer Wald, Elstergebirge, Erzgebirge, Böhmischer Schweiz, Lausitzer Gebirge, Jeschkengebirge, Iser- und Riesengebirge,
Glatzer Schneegebirge und Altvatergebirge. Dieser Weg war anfangs der längste Touristenweg im deutschsprachigen Raum. Anleger: Gebirgsverein
für das nördlichste Böhmen mit Sitz in Schönlinde neben anderen Vereinen, auch die Lusatia war beteiligt mit dem Abschnitt Lückendorf-Lauschekamm
1906 Kegelweg ![]() Jeschken-Milleschauer/Donnersberg (Verschönerungsvereine Leipa, Niemes, Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge sowie die
Jeschken-Milleschauer/Donnersberg (Verschönerungsvereine Leipa, Niemes, Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge sowie die
Leitmeritzer und Lobositzer Mittelgebirgsvereine, alles unter Leitung des Nordböhmischen Exkursionsklubs)
1910 Höhenweg I ![]() im Erzgebirge (Kuhberg - Augustusberg Gottleuba) als Vorgänger für den späteren Saar-Schlesienweg
im Erzgebirge (Kuhberg - Augustusberg Gottleuba) als Vorgänger für den späteren Saar-Schlesienweg
1911 Nördlicher Kammweg ![]() von Görlitz nach Königsbrück über Löbau - Demitz-Thumitz – Butterberg - Keulenberg (Lusatia)
von Görlitz nach Königsbrück über Löbau - Demitz-Thumitz – Butterberg - Keulenberg (Lusatia)
1912 Lausitzer Landweg ![]() ("Lange Leitung") Hutberg Kamenz-Butterberg-Valtenberg-Bieleboh-Kottmar-Oderwitzer Spitzberg-Breiteberg-Zittauer Gegirge,
("Lange Leitung") Hutberg Kamenz-Butterberg-Valtenberg-Bieleboh-Kottmar-Oderwitzer Spitzberg-Breiteberg-Zittauer Gegirge,
ab 1922 über Leutersdorf (Lusatia)
1929 Saar-Schlesienweg ![]() schönster und längster deutscher Fernwanderweg über die Kämme der Mittelgebirge (wurde in der OL von der Lusatia
schönster und längster deutscher Fernwanderweg über die Kämme der Mittelgebirge (wurde in der OL von der Lusatia
betreut), Fertigstellung: 1935
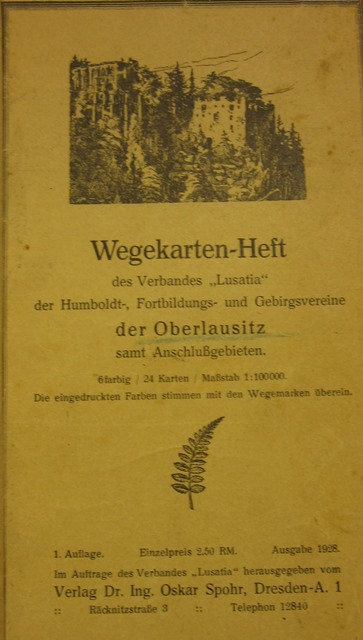 1928
1928 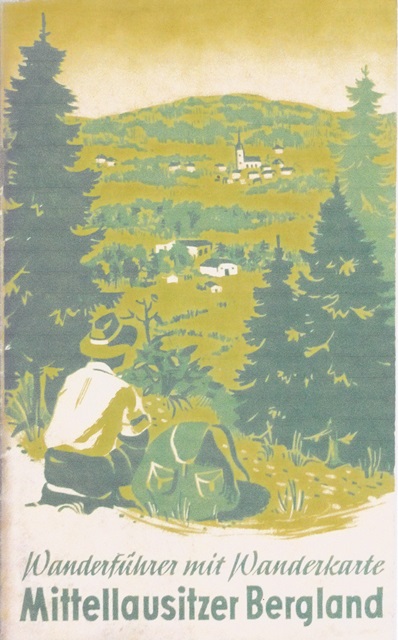 1955
1955
In der Sächsischen Schweiz wurden Maßstäbe in der Markierung und Beschilderung von Wanderwegen für ganz Deutschland gesetzt. Diese Vorbildrolle besteht bis heute!
1878 Erzgebirgsverein in Aue gegründet
1880 Gebirgsverein für die Lausitz am 22.2. in Zittau gegründet, bald wurde daraus die Lusatia; Riesengebirgsverein am 1.8.1880 in Hirschberg gegründet
1888 gab es die Zentralsitzung des Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz (am 3.10. in Pirna)
Das Ergebnis waren die „Grundzüge über die Wegebezeichnung mit Farben“ : an Bäume aufgemalte Striche oder Punkte (praktiziert zuerst am Weg zum
Kuhstall)
1909 es wurden Grundsätze für die neue Wegebezeichnung im Gebiet der Sächsischen Schweiz festgelegt
1909 Der Erzgebirgsverein strebt einen Höhenweg auf sächsischer Seite an, Grundsätze der einheitlichen Wegebezeichnung von E.A.Müller, dazu gab es eine
Wanderkarte
1910 Der Höhenweg I im Erzgebirge wird mit dem blauen Andreaskreuz markiert zwischen Kuhberg und Augustusberg in Gottleuba, es folgen die Höhenwege
II + III (rotes und gelbes Kreuz), die nicht so kammnah aber parallel verlaufen.
1914 In der Sächs. Schweiz werden Befestigungsort, Häufigkeit der Wegemarken, Genehmigungspflicht, Markengröße und Farben beschrieben sowie
handwerkliche Tipps gegeben
1914-18 wurden Ortswegemeister berufen, diese waren Mitglieder im zentralen Wegeausschuss des Gebirgsvereins für die Sächs. Schweiz
1926 ein Verzeichnis der farbig bezeichneten Wanderwege erscheint
1929-37 ist der Studienrat Arno Emmerich aus Sebnitz Vorsitzender, danach 1938-45 Johannes Lehmann aus Heidenau
1929 führt Arno Emmrich, Studienrat aus Sebnitz, die Saar-Schlesien Kennzeichnung ein (als kleine Zusatzbezeichnung zunächst), ab 1935 dann
als eigenes Markierungszeichen: blaues Andreaskreuz bis 1986/87 in den sächsischen Bezirken, in Thüringen bis heute
1930 gegenüber vom Bahnhof Sebnitz wird die erste Wandertafel angebracht: 2,5 x 2 m
1929/ 30 Jahresbericht: „Unsere Sächsische Schweiz gehört heute unbedingt zu den bestbezeichneten Wandergebieten Deutschlands“
man hatte auch ein Wegekarten-Heft herausgebracht
1928 Flößersteig gelb markiert (vom Forstamt)
1935 Polenztal und Wesenitztal erschlossen
1936 Sebnitztalweg: rotes Dreieck
1939 wurde für die Beschilderung festgelegt: weiße Schrift steht auf grünem Schild, Ziele sind in der Reihenfolge des Erreichens und Entfernungen in km
(oder Stunden/Minuten)
anzugeben, Markierung: weißes Quadrat 15x15 cm gemalt oder Blech angenagelt mit Kupfer- oder verzinkten Nägeln bei Nutzhölzern
Alle Einrichtungen zur Markierung genießen behördlichen Schutz
1939-45 Im 2. Weltkrieg und in den Jahren danach verfiel leider vieles
Bautzen: Paul Röber, Sebnitz: Emil Weichholz - Kreiswegewarte
1955 hatte man zentral noch keine Mittel, nur sporadisch örtliche Initiativen, man ging zu Tischlern und Klempnern und bat um kostenlose Hilfe
Beschluss in Bad Schandau für die Kreise Sebnitz + Pirna:
Grüne Schilder mit 1 cm weißem Rand (tannengrün vorn und hinten) + weiße Antiqua-Schrift, 1 Stunde = 4 km
Zuvor gab es keine Einheitlichkeit, z.B. im Zittauer Gebirge weiße rechteckige Wegweiser als Holztafeln mit schwarzer Schrift
1956 erste Übersichtstafeln mit markierten Wegen in Hohnstein, am Ungerturm, Lichtenhainer Wasserfall, Zeughaus,
Schüler sammelten alte Nägel und klopften sie gerade
1956 am 21. März in Berlin Tagung der Natur- und Heimatfreunde im KB:
-Hauptwanderwege werden festgelegt und kartografisch erfasst
-Orts-, Kreis- und Bezirksaktive werden gebildet
-Die Wegemarkierung ist auch ein Anliegen des Heimatkundeunterrichts und unterstützt diesen sehr
1968 im Kreis Sebnitz wurden Mittel für Wanderwege eingeplant, die wichtige Gesetzlichkeit über die Wanderwege kam für die ganze DDR
1972 Tagung in Ostrau mit Festlegung Markierung und Beschilderung: nur noch 4 Farben, Strich, Punkt, Kreuz, Quadrat und Dreieck verwenden
1974 in seiner AG macht Rolf Gullich in Sebnitz als Werkenlehrer mit den Kindern Schwarten für Wanderschilder, auch Bänke werden gebaut,
sie sammelten Müll ein, bauten Geländer, Nistkästen, pflanzten Bäume...
1975 Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit: Utensilien und Ausrüstung (Wanderschuhe, Anorak) wurden vom Kreiswegewart als Belohnung ausgegeben,
ebenso Reisen angeboten und Schulungen durchgeführt
1986 Beschluss am 17.2. in Dresden: nur noch Strich + Punkt + grün-diagonales Lehrpfadzeichen als Markierung, blau + rot mit Vorrang, gefolgt von grün
und gelb
Eine Vereinheitlichung der Wegemarken hatte damals vor allem die ČSSR gefordert, da man dort, wie auch in Polen, nur Strichmarkierungen
verwendete und auch der Fernwanderweg Eisenach-Budapest 1983 entstanden war.
Nach dem Ende der DDR wurden die Normen für die Beschilderung und Markierung im Wesentlichen übernommen. Allerdings fiel die Gesetzlichkeit weg.
In Leutersdorf übernahm ich 1976 das Ehrenamt als Wegewart. Hier hatte es nur noch minimale Reste einer Markierung gegeben, Wanderschilder waren ganz verschwunden, Tafeln keine vorhanden, die meisten Bänke verfallen. So baute ich wie meine Kollegen in vielen anderen Orten der Kreise Zittau und Löbau in dieser Zeit ein neues Wegenetz auf, das die beiden Kreiswegewarte Eberhard Götze aus Zittau und Walther Stavenhagen aus Eibau entworfen hatten. Vieles dabei stützte sich auf alte Wanderwege, die einst vom Lusatia Verband angelegt worden waren. In und um Leutersdorf hatten wir zunächst 5 Wanderwege zu markieren und zu beschildern.
Nach dem Vorbild von Rolf Gullich in Sebnitz bezog ich meine Schüler in meine Arbeit mit ein. Sie kontrollierten Wege und besserten Markierungen aus. Viele Wanderschilder erhielten zur Abdeckung Schwarten. Gemeinsam stellten wir 10 Bänke an landschaftlich besonders schönen Stellen auf. Die Einzelteile der Bänke hatten wir erst gestrichen und dann zusammengebaut. Zum Beispiel war die Wegweisergabel in der Folge eine solche Schülerarbeit von 1987 (sie stand bis 2024). Der Vater eines Schülers arbeitete beim Forst und besorgte eine Holzgabel. Die Schüler schälten die Rinde und nach längerer Trockenzeit kam eine Lasur darüber. Der Bauhof half uns mit einem Beton- und Stahlfundament. Die Kosten waren somit gering. Die Wanderschilder holte ich früher vom Tischler und ließ sie dann nach meinen Entwürfen von der Schriftmalerei in Neugersdorf (PGH) fertig stellen. Heute werden Wanderschilder bedruckt und somit ist Holz dafür kaum geeignet. Eine neue Gabel steht nun in Oberleutersdorf.
Es gab eine AG Wandern an der POS Leutersdorf. Als Wanderleiter ging ich mit meinen Schülern jeweils einen Sonnabend im Monat auf Tour. Als Alternative zu den Ferienspielen im Sommer bot ich ein 14-tägiges "Wanderlager" an. Jeden Tag wurde mit dem Zug ab Leutersdorf ein Wandergebiet angefahren und eine Tageswanderung unternommen oder bei uns im Ort einfach losgewandert.
 2001
2001
Wer schon im Schüleralter beim Erschließen der Schönheiten unserer heimatlichen Landschaft aktiv einbezogen war, ja sogar Verantwortung übernahm, kommt auch später gewiss nicht auf den Gedanken sinnloser Zerstörung.
Viel später kamen weitere Wanderwege und Radwege hinzu: der Karasek-Ringweg (1995 in Zusammenarbeit mit Seifhennersdorf), die Forstenbergrunde (2007), der Victoriaweg (2009) und die Pascherrunde (2017). Über Jahre half ich in Spitzkunnersdorf aus. Heute beraten wir vom Lusatia Verband Gemeinden in der Oberlausitz, die keinen Wegewart haben, wie sie ihr Wanderwegenetz erhalten können.
Der Lusatia Verband legte folgende Wanderwege an:
Der Nördliche Kammweg - von der Landeskrone nach Königsbrück ![]()
Oder umgekehrt, von Königsbrück an der Westgrenze der Oberlausitz geht es über den Keulenberg - Oberlichtenau- Pulsnitz- Schwedenstein - Sibyllenstein – Butterberg – Klosterberg - Neukircher Berg- Picho - Mönchswalder Berg – Czorneboh – Hochstein - Löbauer Berg und Rotstein bis zur Landeskrone bei Görlitz.
Reizvoll ist dieser Wanderweg über die Gipfel der nördlichsten Kette des Oberlausitzer Berglandes, herrlich sind die Aussichten auf das fruchtbare Gefildeland bis hin zum Teich- und Heidegebiet der nördlichen Oberlausitz. sowie auf die südlicher liegenden Bergketten.
Das Wegezeichen des historischen Nördlichen Kammweges war seit seiner Entstehung 1911 der dreizackige blaue Kamm. Das alte Kammzeichen blieb auch über die 50er Jahre noch erhalten. Gleichlaufend damit kam allerdings das rote Andreaskreuz vom neuen Fernwanderweg Görlitz-Greiz hinzu. Ab 1962 wurde im Osten der OL daraus der blaue Ring, seit den 70ern der blaue Punkt ![]() .
.
Dieser besteht bis heute zwischen Görlitz und dem Neukircher Berg (und weiter über Großdrebnitz -Stolpen nach Greiz).
Vom Neukircher Berg bis Königsbrück blieb das rote Andreaskreuz bis Ende der 80er zunächst erhalten. Die Weiterführung über den Klosterberg und den Butterberg ist heute der grüne Strich. Nach einem kurzen Zwischenstück als roter Punkt (Butterberg-Hochstein, hier gingen Landweg und N. Kammweg gemeinsam) führt er dann als roter Strich über den Keulenberg weiter bis nach Königsbrück. Wenn man allerdings dem ursprünglichen Verlauf über Oberlichtenau folgen will, muss man dort heute zusätzlich den blauen und grünen Strich benutzen.
Engagierten Heimat- und Wanderfreunden ist es zu verdanken, dass gerade in der westlichen Oberlausitz, zwischen Schwedenstein und Butterberg, an die historische Wegemarkierung und -bezeichnung z.B. auf einer Tafel erinnert wird.
Nach der Wende wollte man auch bei den Wanderwegen „Flagge zeigen“ und führte den Namen „Wanderweg der Deutschen Einheit“ ein (Görlitz- Aachen), was als Zusatzbezeichnung zum blauen Punkt auf die Karten kam. So recht durchgesetzt hat sich das allerdings in dem Falle auch nicht, da wir ja genügend traditionsreiche alte Fernwanderwege haben, die fest im Gedächtnis der Wanderfreunde blieben.
Der Lausitzer Landweg - vom Kamenzer Hutberg zum Hochwald ![]()
Im Jahre 1912 wurde der Lausitzer Landweg vom Lusatia-Verband und seinen Mitgliedsvereinen in seiner Wegeführung festgelegt und mit der Markierung durch das gespiegelte blaue „L“ begonnen. Er führte über 112 Kilometer vom Kamenzer Hutberg über den Walberg - das Wohlaer Ländchen – Sibyllenstein – Butterberg – Bischofswerda – Valtenberg – Weifa – Bieleboh – Kottmar – Oderwitzer Spitzberg - Breiteberg und Jonsdorf zum Hochwald im Zittauer Gebirge. Heute ist er im Wesentlichen Teilstück des Oberlausitzer Ringweges mit dem roten Punkt.
Der Saar-Schlesienweg - quer durch Deutschland ![]()
Es war eine tolle Idee, als man Ende der 20er Jahre einen Fernwanderweg über die gesamte Ausdehnung, quer durch Deutschland von West nach Ost, anlegen wollte. Über die Kämme der Mittelgebirge, also durch die schönsten Landschaften, sollte er führen. Im Jahre 1929 wurde dies vom Deutschen Wandertag in Königstein an der Elbe beschlossen. Sogleich begann man mit der Markierung, die aber erst 1935 nach dem Referendum im Saarland abgeschlossen werden konnte. Wieder einmal hatte sich Sachsen als Vorbild erwiesen, denn hier hatten 1923 auch die Vorplanungen begonnen. Es gab nämlich bereits seit ca. 1910 den Höhenweg I vom Kuhberg im Westerzgebirge bis nach Gottleuba im Osterzgebirge mit dem blauen Andreaskreuz über 271 km. Die roten und gelben Andreaskreuzmarken standen für die Höhenwege II und III des Erzgebirges. Sie verliefen parallel und nicht so kammnah.
Der Saarschlesische kam vom Elbsandsteingebirge über Sebnitz und Unger bei der Hohwaldschänke in die Oberlausitz hinein. Weiter ging es über den
Valtenberg bei Neukirch- Steinigtwolmsdorf - Prinz-Friedrich-August-Turm- Sohland mit Stausee- Ellersdorf- Kälbersteine- Bieleboh- Neusalza-Spremberg- Kottmar- Herrnhut- Ostritz- Nieda an der Wittig. Hier wurde Sachsen verlassen und der Riesengebirgsverein übernahm die weitere Betreuung im Reststück der OL:
Seidenberg- Marklissa- Tafelfichte. Sodann ging es auf altschlesischem Gebiet über Heufuder- Schneekoppe- Hohe Eule- Glatzer Bergland- Neustadt O.S. weiter. Am St. Annaberg in Oberschlesien endete der Saar-Schlesienweg.
Anfangs verlief er dabei durch beide böhmischen Zipfel: Zum einen über Lobendau nach Sohland und zum anderen hinter Weigsdorf über Friedland und die Tafelfichte. Ab 1933 wurde er dann über Leutersdorf und das Zittauer Gebirge gelegt. Nach 1945 kam allerdings die Unterbrechung durch die innerdeutsche Grenze.
Man verlegte den Weg nun über den gesamten Rennsteig bis nach Wernigerode im Harz. Der Fernwanderweg Zittau-Wernigerode war entstanden.
Bald kam es zu Reduzierungen bei den Markierungen, denn die Vielfalt bei Farben und Zeichen war kaum noch zu überblicken. Reformen waren seit den Nachkriegsjahren durchaus nötig. Es waren in den 50ern neue Fernwanderwege entstanden und mit „Eisenach-Budapest“ gab es 1983 dann den ersten internationalen Wanderweg. Die letzte Wanderwegereform war 1986. Auf Bitten der CSSR wurde nun nur noch eine Strich- und Punktmarkierung in den 4 Grundfarben verwendet. Damit mutierte das Andreaskreuz zum blauen Strich, was Wegewarte und die Wanderer nicht eben hoch erfreute. Blau hatte Vorrang für die Hauptwanderwege, gefolgt von rot für die wichtigsten Gebietswanderwege. Grün und gelb blieben für weitere Gebietswanderwege und die örtlichen Wanderwege. Hinzu kam das Naturlehrpfadzeichen mit dem grünen Diagonalstrich.
Heute begleitet uns der blaue Strich weiterhin auf dem traditionellen historischen Weg. Das Teilstück in der Oberlausitz wurde 1993 zwischen Zittau und dem Valtenberg als Oberlausitzer Bergweg ausgewiesen und seitdem erfolgreich touristisch vermarktet. Wir kämpfen heute allerdings darum, dass unser traditionsreicher Fernwanderweg Zittau-Wernigerode, der Hauptwanderweg der OL, als „Markenname“ nicht verloren geht. Der Weg beginnt in Zittau am Bahnhof und ist auf der dortigen großen Informationstafel als „Fernwanderweg Zittau - Wernigerode“ benannt. Die Tafeln in Spitzkunnersdorf, Leutersdorf und auf dem Bieleboh weisen ihn aus. Auch in Sohland, im Hohwaldgebiet, in Neustadt, Sebnitz und im weiteren Verlauf durch die Sächsche Schweiz und das Erzgebirge taucht der Name auf. Hier gilt es aber größere Lücken in der Markierung und Beschilderung zu schließen. Im Plauener Raum ist der Fernwanderweg gut beschildert.
An historische Wanderwege erinnern (Text des Lusatiaverbandes)
Die Lusatia war also seit 1902/04 bis 1945 immer auch an der Entstehung und Betreuung von Fernwanderwegen beteiligt, ja für diese verantwortlich. Bereits bei der Entstehung des Kammweges hatte man sich gemeinsam mit dem Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen und anderen Vereinen beteiligt.
Die heutigen Wanderwege sind auch ein Teil unserer Kultur- und Heimatgeschichte. Ihre Historie mit langer Tradition sollte und darf nicht in Vergessenheit geraten. So ist gerade der „Markenname“ Fernwanderweg Zittau - Wernigerode für einen Wanderweg von Ost nach West unbedingt erhaltenswert. Unser Minimalziel ist es, zunächst den Wegeabschnitt von Zittau bis Schleiz damit „aufzufrischen“.
Vom Valtenberg führt der blaue Strich über Unger-Sebnitz-Großer Winterberg und ab hier als E3 über Bastei - Königstein - Augustusberg/ Bad Gottleuba - Geising. Weiter führt der Weg als Europäischer Fernwanderweg E3 nach Olbernhau, dann grenznah bis Mühlleithen (teils übereinstimmend mit dem Kammweg), dann wieder bis vor Plauen als E3 und schließlich mit dem Internationalen Bergwanderweg von Eisenach nach Budapest (EB) über Schleiz bis Eisenach. Das blaue Wegezeichen (hier teils noch das historische blaue Andreaskreuz) geht nun weiter bis Wernigerode.
In den betreffenden Wanderkarten des Sächsischen Staatsbetriebes Geobasisinformation und Vermessung ist der Fernwanderweg zwischen der Oberlausitz, der Sächsischen Schweiz, dem Erzgebirge und dem Vogtland durchgehend mit dem roten Schriftzug „Zittau - Wernigerode“ bezeichnet.
Um in jedem Ort, durch den dieser Weg führt, den traditionellen Namen auf zumindest einem Schild anzubringen, ist es meist nur ein geringer materieller Aufwand. Das kann auch ein kleiner zusätzlicher Aufkleber oder ein spezielles Markierungszeichen sein, was nur geringe Kosten verursacht. Auf Orientierungs- und Infotafeln sollte er ebenso auftauchen und vor allem bei den Tourismusverbänden in der Werbung für Fernwanderwege erscheinen.
Sorgen wir dafür, dass auch an die anderen historischen Wanderwege mit ihren ursprünglichen Namen und Markierungszeichen hier und da erinnert wird. Lassen wir nicht in Vergessenheit geraten, was Vereine und Heimatfreunde in den vergangenen Jahrzehnten für sich und für uns geschaffen haben. Am Lausitzer Landweg bzw. Nördlichen Kammweg bemüht sich zum Beispiel der Verein der Natur- und Heimatfreunde Burkau e.V. darum.
(Gemeinsamer Text des Lusatiaverbandes von G.Lang und D.Eichhorn 3/ 2021)
Text, Foto und Abbildungen: Dietmar Eichhorn, Wegewart und Gästeführer Leutersdorf
aktualisiert 3/ 2025